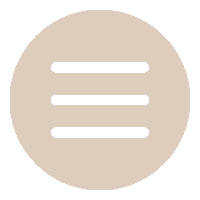Mittelalterliches
Burg Alpen
Die genaue Enstehungszeit der Turmhügelburg von Alpen ist noch unklar. Im Jahr 1200 muss es eine Art Kastell gegeben haben, ab 1320 kann die Existenz einer Burg als gesichert angesehen werden. Erhalten blieb bis heute ein 4m hoher und 70-75m durchmessender Hügel. Der Burggraben ist nur noch in Teilen vorhanden, ebenso sein Wall sowie der Rest eines weiteren Walls einige dutzend Meter entfernt im Westen - offenbar Teil der früheren Vorburg. Auf dem Burghügel gab es eine steinerne Befestigung, oberirdisch ist davon nichts erhalten. 1758 wurde die Burg beim Dürener Erdbeben stark beschädigt, danach setzte weiterer Verfall ein. 1809 wurden die Gebäude abgetragen und ihr Material zum Bau einer Straße verwendet, die bis heute das Burggelände durchschneidet.
Das Innere der Motte wird von neuzeitlichen Schutzräumen durchzogen, die hier durch Bergleute im 2.Weltkrieg ergraben wurden und der Zivilbevölkerung dienen sollten. Die Zugänge zu diesen Stollen waren nach dem Krieg verfüllt worden und ihre genaue Lage unbekannt. Die Abstützung im Inneren wurde seinerzeit mit hölzernen Verstrebungen realisiert, die mit den Jahren verfaulten. Die Folge war ein Einsturz/Abbruch, der dabei auch Teile der Burgfundamente freilegte. Daher ist die Motte seit Mai 2018 eingezäunt und das Betreten wegen Lebensgefahr verboten.
Auf dem Burghügel wurden einige von Pilzbefall stark gezeichnete Bäume gefällt, die innere Struktur der Motte soweit wie möglich analysiert und ein Plan zur Rettung auf den Weg gebracht. In Zukunft soll der Hügel ebenso wie der Stollen wieder begehbar sein und der umlaufende Graben mit Wasser befüllt werden.
Alpen verfügte früher über eine zweite Burg - die Alte Burg ("Aalde Börry") auf einem Höhenzug westlich des Ortes (51.576216, 6.502460).
Fotos aus dem Inneren (RPonline)
Drohnenvideo von A.Speelman
Förderverein Alpener Motte
EBIDAT
Burg Angermund
Die Wasserburg diente als Grenzposten des Herzogtums Berg und war ab Mitte des 15.Jh. Sitz eines bergischen Kellners. Die Ringmauer und ein Teil des Hauptgebäudes stammen aus dem 13.Jh., der ursprünglich im 15.Jh. errichtete Torbau wurde 1635 erneuert. In den 1980er Jahren wurde die marode Burg saniert und zu einer modernen Wohnanlage umgebaut. Die Burg ist nicht zu besichtigen.
Wikipedia
Motte Beeck / Bech
Die Motte liegt ganz in der Nähe von Haus Beeck - einer spätmittelalterlichen Wasserburg. Sehr wahrscheinlich ist die Motte als ein Vorgängerbau zu betrachten, dessen genaues Baudatum unbekannt ist. Die Motte war Stammsitz der Herren von Beeck. Der Ortsname ist seit 1234 bekannt, ein dort residierender Rutger von Beeck ist für das Jahr 1279 verbrieft.
Die Lage der Vorburg ist unsicher - sowohl eine südlich gelegene Fläche, als auch der Grund der späteren Wasserburg kommen dafür in Frage. Die Motte ist heute ca. 6m hoch und hat einen Basisdurchmesser von ca. 42m. Durch Abgrabungen hat sie einen Teil ihrer früheren Größe eingebüßt.
EBIDAT
Bertradaburg - Burg Mürlenbach
Die volkstümlich "Bertradaburg" genannte Burg von Mürlenbach zeigt sich in der Gegenwart als eine Mischung aus Ruine und Rekonstruktion. Auf der dem Tal zugewendeten Ostseite steht der monumentale Torturm mit seinen beiden Rundtürmen. Er stammt vermutlich aus der Gründungszeit der Burg im ausgehenden 13.Jahrhundert, gleichwohl seine 30m hohen Türme und der Mittelbau zum großen Teil aufgemauerte Rekonstruktionen aus den 1990er Jahren sind.
Ein zweiter hangseitiger Zugang wurde Ende des 16.Jh. angelegt, der von heute nur noch ruinös erhaltenen Rondellen flankiert war. Ein mächtiger Schalenturm auf der Ostseite wurde 1870 zu Gunsten einer neu angelegten Fahrstraße gesprengt.
Der dritte Zugang von der Vorburg zur Kernburg stammt aus der Neuzeit und liegt auf der Nordseite. Der vormalige Grundriss der Vorburg ist bis heute nicht ganz klar.
Jahrzehntelang stritten sich die Herren von Prüm und Trier um die Burg, 1576 gelangte sie an Trier. Die Fortifikationen wurden danach ausgebaut, Mürlenbach verlor aber an Bedeutung und bereits 1683 galt die Burg als verfallen.
Der mittelalterliche Pallas neben dem Torbau ist nur noch in Resten vorhanden und wurde zu einem neuzeitlichen Wohnhaus umgestaltet. Die Bertradaburg befindet sich in Landes- und Privatbesitz und ist nicht öffentlich zugänglich. Einige Räumlichkeiten werden als Ferienwohnungen vermietet.
3D-Rekonstruktion
Ebidat
Kasteel Beusdael
Die Wasserburg mit dem imposanten Bergfried soll der Sage nach bereits zur Zeit Karls des Großen errichtet worden sein. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber ein Enstehungsdatum im 13.Jh. Die ersten urkundlich erwähnten Burgherren waren 1323 Johan Schevart van Oy und 1334 Herman van Abousdayl. Die wechselnden Besitzverhältnisse über die Jahrhunderte sind recht gut dokumentiert.
Der kleinere Rechteckturm und die beiden Wohnflügel aus roten Backsteinen stammen aus dem 16.Jahrhundert. Weitere bauliche Veränderungen erfolgten 1882, als eine Kapelle, ein kleinerer Turm neben der Kapelle im Innenhof, Brücke und Torhaus ergänzt wurden.
Das Kasteel wird bewohnt und ist nur bei raren dort stattfindenden Veranstaltungen zu besichtigen.
Trois Frontieres
Burg Blankenstein
Höhenburg aus dem 13.Jh, Bauabschluss in der ersten Hälfte des 15.Jh. Bereits im gleichen Jahrhundert ausbleibende Reparaturarbeiten und beginnender Verfall, der sich im 16. und 17.Jh. fortsetzte - beschleunigt durch wechselnde Besetzungen. Ab 1662 Teilabbruch wegen militärischer Nutzlosigkeit. 1863 Nutzung durch eine Fabrik zur Garnveredelung und bereits ein Jahr später Gastronomiebetrieb, der sich bis heute fortsetzt.
Wikipedia
Château de Corroy-le-Château
Um 1270 wurde die Burg von Corroy durch den Grafen Philippe de Vianden erbaut. Die von einem Wassergraben umgebene Burg hat einen fünfeckigen Grundriß. Neben vier Ecktürmen schützen zwei weitere den Eingang im Torhaus. Ein früher im Innenhof stehender Bergfried wurde zwischen 1718 und 1743 abgetragen, um die Wohnqualität im nördlich und östlich gelegenen Herrenhaus zu erhöhen.
Das Château wird bewohnt und befindet sich seither durchgehend in Familienbesitz.
Wikipedia (F)
Video-Rundgang: Houses of the month - Traces of European History
Burgruine Dreimühlen
Von der Burg Dreimühlen ist nur noch ein kleiner Rest einer früheren Ringmauer erhalten geblieben. Auf der Innenseite sind Balkenlöcher zu sehen - offensichtlich bildete die Mauer gleichzeitig die Rückwand eines um 1825 abgebrochenen Försterhauses.
Früheres Aussehen und Geschichte der kleinen Spornburg liegen im Dunkeln. Da der Name "Dreimühlen" auch an anderer Stelle der Eifel vorkommt, ist eine klare Zuordnung zu archivierten Dokumenten nicht eindeutig. Die Herren von Dreimühlen wurden bereits um das Jahr 1200 erwähnt. 1303 wird ein "festes Haus" beurkundet. 1473 wurde die Burg auf Veranlassung des Grafen von Manderscheid verwüstet und verbrannt um sie dem Zugriff durch den Herzog von Jülich und Berg zu entziehen. Über Jahrhunderte wurde die Ruine nicht wieder aufgebaut, erst in der ersten Hälfte des 18.Jh. wurde ein steinernes Forsthaus an Stelle der Burg errichtet. Nach nur 30 Jahren litt dieses an massiven Bauschäden, die aber wegen Aussichtslosigkeit nicht mehr behoben wurden. 1807 wurde "Haus Dreymühlen" auf Abruch versteigert und in den Folgejahren abgerissen.
Wikipedia
EBIDAT
Burg Gräfgenstein
Die kleine Burg wurde vermutlich im 13.Jahrhundert als Verwaltungssitz und Grenzbefestigung zwischen zwei Herrschaftsgebieten erbaut. Später diente sie als Rittersitz. Im ausgehenden 19.Jh. wandelte sich die Nutzung zu einem Bauernhof. Seit 2021 gibt es einen neuen Eigentümer, die Burg wird derzeit denkmalgerecht saniert und ist nicht zugänglich.
Wikipedia
Haus Gräfgenstein im Angertal – Ein befestigter Wohnsitz im 13. Jahrhundert (PDF)
Hardtburg
Die Hardtburg nimmt mit ihrer Lage und Bauart eine Sonderstellung ein. Sie ist sowohl eine Höhen- als auch eine Wasserburg. Zu verdanken ist dies einer Quellmulde auf einer Höhe des Hardtwaldes in der Nordeifel.
Die Anfänge der damals eher einfachen Burg liegen im 11. oder 12.Jh. Der erste steinerne Wohnturm wurde um das Jahr 1200 in eingemotteter Bauweise errichtet - sein Sockel wurde mit Material aus dem Burggraben umgeben. Wenige Jahre später - die Burg war bereits in einem Konflikt zwischen Staufern und Welfen stark beschädigt worden - wurde sie durch die erste innere Ringmauer verstärkt und um eine erste Vorburg erweitert. Nach 1341 folgten auf Veranlassung des Kölner Erzbischofs weitere Baumaßnahmen zur Erhöhung der Wehrhaftigkeit, die das heutige Erscheinungsbild bestimmen. Die Kernburg erhielt dabei eine zweite Ringmauer und auch die Vorburg wurde mit einer neuen Ringmauer und Schalentürmen verstärkt.
Seit dem 18.Jh. verfiel die Kernburg. Im 19.Jh. wurden in der Vorburg neue Wirtschaftsgebäude errichtet, die seither das Forstamt beherbergen.
Die Hardtburg kann seit 2015 nicht mehr besichtigt werden, anderslautende Informationen im Internet sind veraltet. Bauschäden an der Kernburg und eine morsche Holzbrücke führten zur Schließung. Im Jahr 2020 konnten einige Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, eine bereits für 2017 geplante Sanierung ist bis zum Herbst 2023 noch immer nicht erfolgt.
Wikipedia
EBIDAT
KuLaDig
Haus zum Haus
Gelegen an einer Furtstelle über das kleine Flüßchen Anger, wurde hier bereits im 9.Jh. eine Wallburg erbaut. Nach deren Zerstörung im 12.Jh. erfolgte 1276 der Ausbau zur heutigen Wasserburg. In den 1970er Jahren war die Burganlage marode und wurde von einem neuen Besitzer restauriert und um moderne, optisch angepasste Gebäude ergänzt.
Wikipedia
Burg Helpenstein / Hoffberg
Der heutige Ort Helpenstein war einst Stammsitz des Helpensteiner Adelsgeschlechts, dessen Anwesenheit vor Ort für das ausgehende 11.Jahrhundert nachgewiesen ist. 54 Jahre später bewohnte ein Harpernus von Helpenstein die Helpensteiner Burg. Dagegen ist allerdings das Entstehungsdatum der Burg bis heute ungeklärt.
Im Umfeld des Helpensteiner Burgstalls finden sich im Gelände weitere Spuren von Wehr- und Siedlungsanlagen. Es ist ein Umfeld, in dem Keramikfunde aus der Zeit um ca. 800 n.Chr. gemacht wurden. Indizien deuten darauf hin, dass diese Bodenstrukturen auf einen vormaligen Fronhof (Herrenhof) mit eigener Motte hindeuten.
Man kann nun vermuten, dass die dort wohnenden Helpensteiner später ganz in der Nähe einen neuen Burghügel errichten ließen - den heute sogenannten Hoffberg. Im ausgehenden 13.Jh. bestand die Burg aus einer Hauptburg und zwei Vorburgen.
Im 14.Jh. begann ein Konflikt, der schließlich das Ende der Burg besiegelte. Die Helpensteiner hatten zu dieser Zeit den Vogt in der Burg Hülchrath gestellt, die damals den Herren von Kleve gehörte. Dietrich Luf von Kleve verkaufte Hülchrath an den Erzbischof Heinrich von Virneburg. Jener bezahlte den Kaufpreis in Raten über 9 Jahre hinweg und bestellte seinerseits keinen eigenen Burgvogt für Hülchrath - was ihm auch aus Sicht von Dietrich Luf von Kleve nicht zugestanden hätte. Die Helpensteiner hatten in dieser Zeit wohl nicht nur den Posten des Vogtes, sondern auch des Amtmannes inne. Nach Begleichung des Kaufpreises setzte der neue Besitzer einen neuen Amtmann ein, der nicht dem Landgericht unterstand und Exekutionsgewalt besaß. Der District Hülchrath gehörte aber zu den Herren von Helpenstein, womit der Konflikt vorprogrammiert war.
1329 marschierte Heinrich von Virneburg mit seinem neuen Amtmann und zahlreichen Truppen gegen die Helpensteiner Burg und die dort residierenden vier Helpensteiner Brüder. Die Burg wurde im Kampf genommen und erstmals geschleift, zwei Helpensteiner Brüder wurden gefangen genommen, ein dritter fiel im Kampf. Im Juli 1329 unterzeichnen die überlebenden Brüder ein Dokument, indem sie sich
Aber anders als gedacht werden die Helpensteiner zu herrschenden Vasallen des Erzbischofs und unter Wilhelm V. von Helpenstein wird die Burg wieder aufgebaut. Er nannte vier Kinder sein eigen: Friedrich und Philipp teilten sich die Herrschaft, Tochter Aleidis heiratete in das Geschlecht der von Linnepe und der älteste Sohn Wilhelm verschwand aus den Geschichtsbüchern. 1367 ermordete Friedrich seinen Bruder Philipp und wurde vorübergehend von Gumprecht von Alpen eingekerkert. Jener war ein Verwandter, der nun seinerseits Begehrlichkeiten für den Helpensteiner Besitz entwickelte. Er nahm den Ehemann von Aleidis in Geiselhaft um einen Verzicht auf dessen Erbanspruch auf Helpenstein zu erwirken - was ohne Erfolg blieb. Der Mörder Friedrich saß inzwischen wieder auf seiner Burg in Helpenstein. 1370 hatte Köln einen neuen Erzbischof gewählt. Nach Kunde der Helpensteiner Verhältnisse zog er mit einem Heer gegen Helpenstein, zerstörte die zweite Burg und nahm Friedrich in Haft. Nun witterte Gumbrecht seine Chance: er bemächtigte sich des Burghofes (daher auch "Hoffbersch" - der Burgberg neben dem Hof). Nach weiteren Ungesetzlichkeiten wurde auch er 1374 gefangen genommen und weggesperrt. Vier Jahre später verzichtete er auf seine Ansprüche und entließ nach 12 Jahren den noch immer sich in Geiselhaft befindenden Johann von Lynnepe - den Mann von Aleidis. Frei war er dennoch nicht - er wurde sogleich vom Kölner Erzbischof in erneute Geiselhaft gesteckt, um Aleidis zu einem rechtlichen Verzicht auf Helpenstein zu bewegen. Aber weder sie, noch Johann gaben dem nach. Johann starb nach 25 Jahren in Haft, danach vereinnahmte sich das Domkapitel endgültig den Besitz.
Übrig geblieben ist heute vor allem der bewaldete Burghügel, der durch den Bau eines Eisenbahndamms geteilt wurde und ohne weiteres Hinweisschild leicht zu übersehen ist.
EBIDAT
Herrschaft Helpenstein
Wikipedia
Motte Hombroich / Fusseberg
Abgestufter Mottenhügel am Ufer der Erft, über den kaum etwas bekannt ist. Als Besitzer im Jahr 1237 ist ein Gerardus de Hunebruc belegt, der seinen Besitz 1268 an seinen Sohn Wilhelm weiter geben konnte. Mangels Nachkommen ist die Familie wohl ausgestorben, der Grundbesitz ging an den Deutschen Orden.
Die Motte ist noch etwa 4-5m hoch, der Basisdurchmesser liegt bei ca. 32m. Ein Graben ist - auch bedingt durch landwirtschaftliche Tätigkeit - vor Ort kaum zu erkennen, zeigt sich aber als leichte Vertiefung im Satellitenbild. Eine Vorburg ist nicht vorhanden bzw. erhalten.
EBIDAT
KuLaDig
Schloss Hülchrath
Schloss Hülchrath - so wie es sich heute darstellt - ist zu einem großen Teil ein von der Neogotik inspirierter Neubau des 20.Jahrhunderts. Dennoch sind einige wesentliche Teile aus früheren Bauphasen erhalten geblieben.
Die Gründung von Burg Hülchrath geht auf eine Motte zurück, die hier um die erste Jahrtausendwende entstand. Um 1120 existierte bereits ein steinerner Rundturm, von dem nur ein rekonstruiertes Fundament erhalten blieb. Zwischen 1200 und 1255 erfolgte ein Ausbau zu einer wehrhaften Wasserburg. Als kurkölnische Landesburg wurde der Burg Mitte des 14.Jahrhunderts eine bauliche Verstärkung zu Teil. Zusammen mit Burg Linn verkörperte die einstige Burg Hülchrath innerhalb der kurkölnischen Landesburgen den Typus einer polygonalen Rundburg. 1499 konnte sie einer Belagerung ohne Schäden widerstehen. Dies verlief anders im Truchsessischen Krieg, als die Burg 1583 erobert und beschädigt wurde.
Ab 1609 wurde die Anlage weiter verstärkt, fiel aber 1642 nach einer Belagerung ein weiteres mal. Ihr vorläufiges Ende kam 1687 nach einer Belagerung während des französisch-niederländischen Krieges. Es folgte weiterer Zerfall und ein Teilabriss während des 19.Jahrhunderts. Erst ab 1907 und einem Besitzerwechsel erfolgte ein idealisierter Wiederaufbau und der Namenswechsel von "Burg" zu "Schloss".
Der Komplex befindet sich heute in Privatbesitz und wird bewohnt. Fotografieren ist nur mit expliziter Genehmigung gestattet, eine freie Besichtigung nicht möglich.
Wikipedia
Burg Klempenow
Ursprünglich von Wassergräben umgebene Niederungsburg, erbaut ab 1231, erste urkundliche Erwähnung 1331. Im Laufe ihrer Geschichte litten Burg und Nebengebäude unter eroberungsbedingten Zerstörungen und einem instabilen Untergrund. Die heutigen Gebäude zeigen den Ausbaustand von ca. 1820.
→ Wikipedia
Motte Kyburg / Erprather Burg
Zu sehen sind heute nur noch geringe Reste der im 13.Jh. erbauten Burg. Die sichtbaren Mauerreste sind das Überbleibsel eines Wohnturms, der in den Untergrund der Motte hinein ragt und dessen knapp 5m Höhe so nicht direkt ersichtlich sind. Beim Bau des Turms wurde Abbruchmaterial römischer Bausubstanz verwendet.
Ursprünglich war sie Sitz der Herren von Erprath. Nach dem Aussterben dieses Geschlechtes gelangte sie später in den Besitz des Kölner Erzbischofs und diente danach als kurkölnische Landesburg.
Zerstört wurde sie 1586 im Truchsessischen Krieg, bei dem es um den Versuch des Kölner Kurfürsten ging ein weltliches Fürstentum zu errichten.
EBIDAT
Wikipedia
Burg Linn
Im 12.Jahrhundert Umbau einer Motte zu einer Burg mit Ringmauer aus Tuffstein. 1188 Änderung der Pläne und Verwendung von stabileren Backsteinen als Material, sowie Einbau von 6 runden Flankierungstürmen. 1704 und 1715 durch Brände weitgehend zerstört. Erneuter Aufbau der Ruine ab den 1950er Jahren. Heutiger Baubestand größtenteils aus dem 13.Jahrhundert.
Wikipedia
Archäologie Krefeld
Burg Lissingen
Ehemalige Wasserburg, die 1559 durch Teilung zu einer Ganerben- / Doppelburg der Brüder von Zandt wurde. Im Keller der Unterburg finden sich Reste eines Wehrturms aus dem vermuteten 10. oder 11. Jh.n.Chr. Eine erste urkundliche Erwähnung der Burg gibt es aus dem Jahr 1212. Während 200 Jahren entstanden auf dem Boden dieser Wirtschaftsburg drei Wohntürme, die 1662 im Herrenhaus der Unterburg aufgegangen sind. Zuvor war es bereits zu der erwähnten Teilung gekommen, der zur Folge es nun zwei Herrenhäuser, zwei Burghöfe und zwei Vorburgen gab.
Die Teilung betraf auch die Burgkapelle der Oberburg. Nach Streitigkeiten erging 1705 ein richterlicher Erlaß, wonach die Familien von Ahr und von Zandt gegenüberliegende Eingänge zu benutzen hatten. 1783 erfolgte ein Neubau der Kapelle.
Die Teilung der Burg hat sich bis zum heutigen Tag erhalten, beide Hälften haben verschiedene bürgerliche Besitzer. Gemeinsam ist den Burgen, dass sie nur nach Voranmeldung besichtigt werden können - ansonsten bleiben die Tore geschlossen. Die Burgen gehören neben Eltz und Bürresheim zu den wenigen nie zerstörten Burgen der Eifel.
Wikipedia
Motte Burg Neuhaus
Kleiner Turmhügel in der Niederung östlich des Gutes Neuhaus. Das Objekt liegt auf Privatgrund und kann nicht besichtigt werden. Der Hügel wurde in Teilen mit Findlingen befestigt. Erste Erwähnung 1239 in Verbindung mit dem Besitz der Familie Ghikowe. Das benachbarte Gut Neuhaus gehörte ursprünglich zum Besitz der Ritter von Ghikow und wurde 1484 neu erbaut. Burg Neuhaus könnte einen Vorgängerbau darstellen (spekulativ). Der heutige Gemeindename "Giekau" geht zurück auf den slawischen Ortsnamen "Gikowe".
Wikipedia
Ringwall Oldenburg
Oldenburg ist ein alter Siedlungspunkt, der früher günstige Landverbindungen und einen direkten Zugang zur Ostsee besaß. Durch die Verlandung des Gruber Sees und die Verrohrung des Oldenburger Grabens ist dies heute nicht mehr zu erkennen.
Um das Jahr 700 entstand dort als erste befestigte Anlage ein Ringwall, der im heutigen westlichen Teil des Oldenburger Walls aufgegangen ist. Darin stand der Fürstenhof eines wagrischen Herrschers. Die Wagrier waren ein Stammes-Teil der slawischen Abodriten, ihre westlichste Ausbreitung fanden sie bis zu den den Flüssen Schwentine und Trave. Das Zentrum ihres damaligen Herrschaftsgebietes war Starigard - das heutige Oldenburg.
In den Jahren nach 750 wurde der einfache Ringwall weiter ausgebaut, die frühere Vorburg wurde nun mit einbezogen, wodurch sich der Grundriss von einem Kreis zu einer "Acht" wandelte. Ab 1137 kam es in Wagrien zu politischen Änderungen. Von Westen erhoben die christlichen Sachsen Ansprüche, denen die heidnischen Wagrier in Kämpfen unterlagen und zu großen Teilen ihr Land verließen. Ab 1143 rückten Friesen, Niederländer und Westfalen nach und übernahmen die ehemals wagrischen Ländereien. 1148/49 waren es die Dänen, die die Burg von Oldenburg eroberten und zerstörten. 1227 ging sie nach Kämpfen zwischen Dänen und einem norddeutschen Bündnis an das Schauenburger Adelsgeschlecht. In dessen Folge wurden baulche Änderungen vorgenommen, die zu einer dreiteiligen Burganlage führten. Bereits 1261 wurde sie bei erneuten Kämpfen wieder zerstört und nicht wieder aufgebaut.
Weitere Zerstörungen erlitt der Wall 1833, als Teile eingeebnet wurden. Ende der 1980er Jahre wurden die Wälle teilweise rekonstruiert und geben mit ihrer Höhe von bis zu 18m in etwa die Ausbaustufe des 13.Jh. wieder.
Wikipedia
Motte Ophoven
Als Uphoven (später Ophoven) wurde um 1200 erstmals ein einzelner Hof erwähnt. Die Hofanlage der Herren von Ophoven besaß neben Motte und Vorburg noch eine Mühle. Die hochmittelalterliche Motte wurde 1326 erstmals urkundlich erwähnt. Zum Ende des 15.Jh. wurde die Motte aufgegeben, stattdessen kam es zu einem Ausbau der Vorburg zu einer Wasserburg. Diese burgähnliche Hofanlage brannte 1890 nieder.
Das heutige Erscheinungsbild muss in Teilen als Rekonstruktion betrachtet werden - insbesondere die Vorburg wurde im 20.Jh. von neuem nachgebildet. Der Mottenhügel war in der Zwischenzeit teilweise abgetragen worden und wurde mit Sand wieder aufgeschüttet. Seine alte Größe hat er damit aber nicht mehr erreicht.
EBIDAT (Motte)
EBIDAT (Wasserburg)
Burg Rheinfels
Erbaut 1245 als linksrheinische Zollburg. Im 14.Jh. erhebliche Ausbaumaßnahmen mit mehreren Türmen. Die Burg wurde mit Beginn des 15.Jh. zu einer Residenz mit ausgeprägter höfischer Kultur. Im gleichen Jahrhundert folgten Besitzerwechsel und Erbstretigkeiten. Das 16.Jh. sah einen Ausbau zu einem Renaissenceschloss und weitere Sanierungen. Kämpfe während des 30jährigen Krieges beschädigten die Burg, danach wurde sie in der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts hangaufwärts zu einer mächtigen Festung auf dem Wackenberg ausgebaut, die sich nun gegen Frankreichs Interessen wand. Mehrere Belagerungen durch die Franzosen konnten abgewehrt werden. 1758 wurde die Festung erstmalig kampflos an französische Truppen übergeben, ein weiteres mal 1794. In den drei folgenden Jahren wurden Festungswerke, Schloss und Bergfried von französischen Revolutionstruppen gesprengt.
Der flächenmäßig größte Teil der heutigen Ruinen stammt von den Festungsanlagen des 17.Jahrhunderts und ist nicht zugänglich. Begehbar sind vor allem die Überbleibsel des 13.-16.Jahrhunderts.
→ Wikipedia
Burg Schönecken / Clara Costa
Im April 1249 wurde die Burg erstmalig unter dem Namen Clara Costa urkundlich erwähnt. Mit ihrem Bau könnte bereits im 12.Jh. begonnen worden sein. Ihre Aufgabe bestand im Schutz der Südgrenze der Fürstabtei Prüm und in der Kontrolle der durch das Tal führenden Straße.
Bereits 1132 wurden die Grafen von Vianden als Burgvögte der Fürstabtei Prüm genannt. Graf Heinrich I. von Vianden (1214–1252) machte sich bei dem Kloster unbeliebt, da er ohne Zustimmung des Abtes mit dem Bau der Burg Schönecken begann. Erst 1280 endete der Streit nach einer Burgeroberung und dem Schließen eines Vergleichs unter seinem Enkel Heinrich II. von Vianden. Dieser nannte sich bereits seit 1264 Herr von Schönecken und gründete dort die bis 1370 bestehende Seitenlinie der von Schönecken.
Mit dem Tod des letzten adeligen Schöneckers gingen Ort und Burg an Luxemburg und kurz danach an den Trierer Kurfürsten und Erzbischofs. Die Burg wurde mit einem Amtmann besetzt und diente als Stützpunkt in den Konflikten mit der Abtei Prüm. Nach deren Integration in den Kurstaat verlor Burg Schönecken ihre strategische Funktion.
Bis 1718 war die Burg noch Sitz eines Amtmannes, der dann in die neu erbaute Kellnerei im Tal umzog. Danach setzte der Verfall der Burg ein. 1802 verwüstete ein Feuer den Ort und die Burg Schönecken. 1804 wurde von der damaligen französischen Verwaltung die Erlaubnis zum Abbruch der Burg gegeben, das Material wurde daraufhin zum Wiederaufbau des Ortes verwendet.
In Schönecken gibt es noch ein festes Haus, das teilweise aus der Zeit des Burgenbaus stammt. Dies ist das "Haus Arenth", in dem früher bis 1592 die Burgmannen des Geschlechts "von Hersel" lebten. Es verfügt über Mauern bis zu 2m Dicke und einen eigenen 12m tiefen Brunnen. Das untere der beiden Kellergeschosse diente einst wohl als Verlies.
Wikipedia
KuLaDig
Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier
Château de Sombreffe
Ehemalige Wasserburg, die an der früheren Grenzlinie zwischen der Grafschaft Namur und dem Herzogtum Brabant liegt. Der Bergfried aus dem 13.Jh. bildete den Kern der Anlage, die später zwei Wehrmauern erhielt und um weitere Türme (8 oder 9) sowie einen zweiten Donjon ergänzt wurde.
Das Château wird bewohnt und dient heute als Eventlocation für Konferenzen oder Hochzeiten.
Wikipedia
Burg Thurant
Die Burg Thurant liegt an einem Steilufer der Mosel. Ihre Erbauung geht auf eine Zeit zwischen 1198 und 1206 zurück, ihr Name wurde einer Kreuzfahrerburg im Libanon entlehnt. Zu einer Besonderheit wurde sie nach 1248, als sie zwischen den Erzbistümern Trier und Köln aufgeteilt wurde. Sie erhielt eine Trennmauer und beide Hälften verfügten über einen Bergfried, Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie einen separaten Eingang.
1542 galt sie bereits als baufällig und wurde als Steinbruch benutzt. 1689 wurden durch französische Truppen weitere Zerstörungen hinzu gefügt, lediglich die Bergfriede und ein Wohnhaus überstanden die Maßnahme. 1812/13 wurde der Kölner Pallas durch napoleonische Truppen zerstört.
1915/16 gab es einen ersten Wiederaufbau. Nach Zerstörungen im 2.Weltkrieg wurde das Herrenhaus zwischen 1960 und 1962 rekonstruiert.
Die Burg befindet sich seit 1911 in Privatbesitz und wird bewohnt, kann aber ohne Führung besichtigt werden.
Wikipedia
Motte Zoppesmur / Burgruine Leysiefen
Was hier landläufig als Motte bezeichnet wird, ist eigentlich eine Mischung aus Wasserburg und Höhenburg. Gebaut wurde sie auf einem Sporn, bergseitig durch einen Graben und talseitig durch einen mächtigen Wall geschützt. Durch den Graben fließt der Bach "Leysiefen", das Aufstauen desselbigen würde die Gräben unter Wasser setzen.
Keramische Grabungsfunde aus dem Burghügel datieren sowohl auf das 11./12. Jh, als auch auf das 13.Jh. Man darf vermuten, dass hier anfangs ein hölzernes Wehrhaus gestanden hat, das später durch ein steinernes Befestigungswerk ersetzt wurde, dessen Mauerreste heute noch zu sehen sind.
Die Burg Leysiefen stand auf einem ca. 40x40 m großen Plateau und war von einer Ringmauer umgeben. Im Nordwesten der Anlage befinden sich die Fundamentreste eines Turmes.
Die Burgherren entstammten dem Geschlecht der Zobbe (Zobbo, Sobbe), später umbenannt in de Leysiefen. Dieser Name taucht bereits 1209 in den Geschichtsbüchern auf und markiert wohl ein ungefähres Entstehungsdatum der Burg. Die Sippe der Zobbes endet 1307 mit Ritter Adolf von Leysiefen, der noch zu seinen Lebzeiten das "Schloss Leyensiefen" 1280 (1286?) an Graf Adolf von Berg verkauft. Dies geschah während einer Fehde zwischen derer zu Berg und dem Kölner Erzbischof (die mit der Schlacht bei Worringen ihr Ende fand). Der Kauf hatte möglicherweise strategische Gründe, die Burg wird nach dem Besitzerwechsel nicht weiter urkundlich erwähnt und verfiel. Ihre Funktion übernahm die benachbarte Burg Nesselrode (Nesselrath). Auch diese Burg ist inzwischen verschwunden, nur wenige Teile ihrer Vorburg überstanden die Zeit im heutigen Gut Nesselrode.
EBIDAT
Wikipedia
KStA
Quelle: www.lipinski.de/burgen/13jahrhundert.php
Abgerufen: 27.07.2024 - 12:58 Uhr
Autor: Klaus Lipinski, Düsseldorf
Email: info(at)lipinski.de
Texte und Fotos unterliegen den auf der Website definierten Urheberrechten.
Abgerufen: 27.07.2024 - 12:58 Uhr
Autor: Klaus Lipinski, Düsseldorf
Email: info(at)lipinski.de
Texte und Fotos unterliegen den auf der Website definierten Urheberrechten.