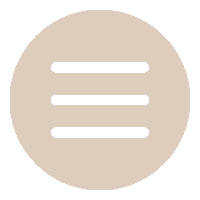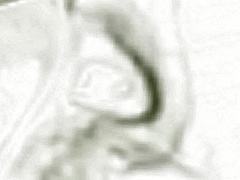Mittelalterliches
Burgwall Altenkrempe
1170 wurde Crempine erstmals als Gewässername erwähnt. Davon leitete sich der slawische Ortsname Crempene ab (1197 erstmals erwähnt) - aus dem später Altenkrempe wurde. Gemeinhin wird geschrieben, dass hier eine Hafenstadt in Konkurrenz zu Lübeck geplant war, was aber daran scheiterte, dass es an Wegen mangelte und der Zugang zur Ostsee über einen Flachwassersee führt und daher für Handelsschiffe ungeeignet war. Aus diesem Grund soll 1244 Nyge Crempe / Nyestad (Neustadt) gegründet worden sein und Crempene 1316 zu Oldhenkrempe umbenannt worden sein. Altenkrempe als Ort wurde aber nie aufgegeben.
Um 1190 begann man in Altenkrempe mit dem Bau einer Basilika- möglicherweise als Abschluss der Christianisierung der dort lebenden Slawen. Die Basilika wurde auf dem Gelände einer alten Wallburg errichtet. Dieser Burgwall wird sehr wahrscheinlich slawischen Ursprungs sein, weitere Informationen und Datierungshinweise liegen nicht vor.
Wikipedia
Daten der Gründung von Neustadt und Altenkrempe
Alte Burg ("Aalde Börry, Altes Kastell") Alpen
Auf einem Sporn der Bönninghardt - einer bis zu 46m hohen Endmoräne - liegt eine Befestigungsanlage mit weitgehend unbekannter Historie. Die Vermutung, dass es sich um ein römisches Kastell handelt, konnte nicht bestätigt werden. Die Legionäre Roms hinterließen einige hundert Meter nordwestlich ihre Spuren in Form eines Marschlagers. Die hier auf dem Schmuhlsberg liegende Wallanlage könnte aus fränkischer Zeit stammen und die älteste der Burgen Alpens darstellen.
Die "Alte Burg" besteht aus einem halbkreisförmigen Abschnittswall, auf den anderen Seiten bot der steile Hang der Moräne einen natürlichen Schutz. Die Befestigung macht außerdem Gebrauch von natürlichen eiszeitlichen Einschnitten. Noch nicht nachgewiesen und nur vermutet wird sie als Sitz der Herren von Alpen aus dem Hause von Dornik zu Beginn des 12.Jh. Ebenso wird vermutet, dass die auch als "Altes Kastell" bezeichnete Anlage möglicherweise um das Jahr 1100 aufgegeben wurde.
Die "Alte Burg" wurde unter der Nummer 38 in die Liste der Bodendenkmäler von Alpen eingetragen. Dies stellt aber offenbar keinen Hinderungsgrund dar, sie als Übungsplatz für Mountain-Biker zu verwenden, die mit ihren Spuren die Erosion der Wälle beschleunigen werden.
Römerlager am Höhenweg
Ringwall Blocksberg bei Pansdorf
Altslawische (Obodritische) Wallburg des 8./9.Jh, die nach einer Unterbrechung noch einmal während des 11./12.Jh. genutzt wurde. Die ringförmige Fluchtburg wurde auf einem Geländerücken errichtet, der auf seiner Westseite einen 20m hohen Steilhang hinunter zur Schwartau aufweist. Die Schwartau war in früheren Zeiten schiffbar und verband den Ringwall am Blocksberg mit Liubice (Alt-Lübeck) an der Mündung in die untere Trave. Der Ringwall des Blocksberg hat eine Ausdehnung von 110-120m und gilt als eine der eindrucksvollsten Ringwallanlagen in Ostholstein.
Im Osten und im Süden gibt es jeweils einen Einschnitt im Wall. Der südliche stellt nach heutigem Kenntnisstand den früheren Torzugang dar, während der östliche Einschnitt neueren Datums ist.
Der Wall ist an seiner Basis 20-25m breit und erreicht eine Höhe von 5-8m. Der Innenraum ist eben. Im Bereich des südlichen Eingangs wurde eine Pflasterung aus Rollsteinen gefunden. Vermutlich setzte sich die Pflasterung über den Graben fort in Richtung der vermuteten Vorburg auf dem Ohlborg.
Wikipedia
Farver Burg Grammdorf
Nicht ganz einfach zu erreichen liegt die slawische Höhenburg auf einem Höhenzug, der auf zwei Seiten von Bächen umspült wird (Testorfer Au und Steinbek). Der Ringwall hat einen Durchmesser von ca. 80m. An seiner Nordseite ist eine Lücke erkennbar - offenbar der frühere Zugang. Im Westen und Osten fallen Wall und Hang steil ab. Das Plateau der Wallburg ist stark bewachsen.
Die Wallburg war bis in das 12.Jh. in Gebrauch.
Motte Flachenhof
Eine Datierung zur Gründung der Motte ist mangels Urkunden oder Funde nicht möglich. Gefundene Scherben stammten aus dem 12.Jh. und geben ein Indiz für das Nutzungsende der Turmhügelburg. Bis 1879 war der Wall durch Steine befestigt. Der eigentliche Turmhügel ist nur noch zur Hälfte erhalten. Von der Vorburg existiert nur noch ein winziger Rest im Winkel zwischen Autobahn und Eisenbahntrasse.
Die Motte Flachenhof gilt als Vorgänger der nahen ehemaligen Wasserburg "Dückeburg".
Wikipedia
EBIDAT
Motte Garath
Die Motte in Düsseldorf-Garath ist bislang noch nicht näher untersucht worden - eine genaue zeitliche Einordnung ist daher nicht möglich. Sie ist eine typische Wehranlage für das untere flache Rheinland des 10. bis 12. Jh. Der Graben um den etwa 30x25m umfassenden Burghügel wurde zugeschüttet und ist nicht mehr erkennbar. Zusammen mit der Motte Unterrath ist sie eine der letzten beiden noch vorhandenen Motten auf Düsseldorfer Stadtgebiet.
Die einstige Vorburg der Garather Motte ging später im westlich gelegenen "Kapeller Hof" auf, der in den 1960/1970er Jahren der Wohnbebauung weichen mußte. Als Sitz des lokalen Adels folgte auf die Motte mit großer Wahrscheinlichkeit der in der Nähe gelegene Rittersitz "Haus Garath" (heute "Schloss Garath").
Garath erhielt seinen Namen durch das Rittergeschlecht von Garderode, das 1271 urkundlich verbürgt wurde. Möglicherweise existierte deren Rittersitz bereits im 9.Jh. - aber bislang ist das noch reine Spekulation.
EBIDAT
Aus Garaths Frühgeschichte: Die Garather Motte
Wallburg Giekau ("Wallberg")
Am östlichen Ufer des Selenter Sees liegt ein slawischer Burgwall mit einem Durchmesser von ca. 90x100m. Grabungsfunde (Keramikscherben vom Typ Menkendorf) deuten auf eine Nutzung vom 9-10-Jh. Möglicherweise wurde die Anlage auch noch im 11.Jh. genutzt.
Der Wall ist heute bewaldet, das Innere der Anlage wird als Schafweide genutzt. Die Westseite des Walls wurde durch den Bau einer Landstraße zerstört, die nun durch den Ringwall hindurch führt.
Slawische Burganlagen in Schleswig-Holstein
Motte Gubisrath / Haag
Im kleinen Weiler Gubisrath befindet sich der Rest einer Motte aus der Zeit des 10.-12- Jahrhunderts. Die Hauptburg war einst von einem Wassergraben umgeben, der von einer natürlichen Quelle gespeist wurde. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall, im Graben sammelt sich nun nur noch Oberflächenwasser.
1355 wurde dokumentiert, dass sich auf dem Burggelände ein deutlicher Baumbestand entwickelt hatte - ein Zeichen dafür, dass die Burg bereits damals ihre Funktion verloren hatte.
KuLaDig
Motte Helpenstein / Duivelsberg
Die hier gezeigte Motte Helpenstein ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Burghügel bei Neuss. Mitten im Sumpf des Helpensteiner Bachtals gelegen, soll die Kleinmotte einst als Fluchtburg gedient haben. Weder Lage noch Größe des flachen Hügels lassen erwarten, dass es sich hier einmal um einen Adelssitz gehandelt haben könnte. Leider sind keine weiteren Informationen vorhanden.
Ringwall Holterhöfchen
Der Ringwall Holterhöfchen stellte nach klassischer Meinung eine Fluchtburg des 10.Jh. dar. Das bedeutet, dass die Anlage nicht permanent bewohnt wurde und nur für Notfälle erbaut wurde. Eine jüngere Interpretation geht jedoch davon aus, dass es sich um einen befestigten Hof aus Holzbauten gehandelt haben soll.
Die beiden Ringwälle bestanden aus steinernen Mauern, wobei die äußere 1,2m dicke Mauer beidseitig mit Erdaushub angeschüttet wurde, die innere 1m dicke Mauer aber nur auf ihrer Innenseite. Im Westen verliefen Handelswege, auf dieser Seite war der Ringwall verstärkt. Schutz bot zudem der Mühlenbach, der sie in früherer Zeit umfloss und dessen Verlauf zu Beginn des 19.Jh. geändert und trocken gelegt wurde. Die ovale Form der Befestigung mit zwei Ringwällen ist untypisch für derartige Anlagen im Rheinland. Es wird vermutet, dass ihr Erbauer ein aus dem Osten oder Norden zugewanderter Kleinadeliger gewesen ist.
Im südöstlichen Abschnitt befinden sich im Bereich des äußeren Ringwalls die Mauerreste eines Gebäudes von 6,5x7m Fläche. Dieses Gebäude wurde erst später errichtet und war möglicherweise ein Turm neben dem Zugang zum inneren Bereich.
KuLaDig
Wikipedia
EBIDAT
Katzburg / Hassendorf
Früh- bis mittelslawische Niederungsburg des 9. und 10.Jahrhunderts. Es gibt keine Erwähnungen in Besitzurkunden, vermutlich wurde die Wallburg danach nicht weiter genutzt. Gefundene Ziegelbruchstücke deuteten allerdings auch auf eine Nutzung in der folgenden frühdeutsch-mittelalterlichen Zeit hin.
Das Areal der Burg beläuft sich auf eine Fläche von ca. 100x80m. Die Größe, die Abwesenheit von Bebauungsspuren im Inneren und fehlende urkundliche Zeugnisse lassen auf eine Nutzung als Fliehburg schließen.
Der Wall wurde teilweise eingeebnet. Seine Höhe beträgt heute ca. 3-5m und war früher vermutlich um die 7m hoch. Angelegt wurde die Wallburg auf einer leicht erhöhten Fläche, umgeben von einer feuchten Niederung. Auf der Nordseite trennt ein Graben die Burg von der Hochfläche, auf den der Niederung zugewandten Seiten ist der Wall etwas niedriger.
Die Wallburg kann nur von einer kleinen Aussichtsstelle aus betrachtet werden.
Burgenarchiv
Wikipedia
Motte Keyenberg
Zur Motte Keyenberg gibt es mehrere Deutungen. Die erste sieht in der Motte eine befestigte fränkische Bauernsiedlung des frühen Mittelalters, bei der die Motteninsel als Wohnsitz des Burgherren diente. Daneben gibt es auch die Interpretation einer Fluchtburg ohne solch ein Wohngebäude.
Hinzu gesellt sich die auf ausgegrabene Mauerreste und Verkaufsakten stützende Ansicht, dass es sich hier um das untergegangene Rittergut Patteren handelt. Wobei auch in diesem Fall nicht sicher ist, ob die Motte nicht doch aus der Zeit vor diesem Rittergut stammt. Wie heißt es doch gleich: "Nichts genaues weiß man nicht."
Die Brücke zur Motte ist durch auf ihr liegende Baumstämme versperrt. Der Wassergraben ist ausgetrocknet, gleich nebenan verschlingt der hunderte Meter tiefe Braunkohlenabbau Landschaft und Dörfer und senkt damit auch den Grundwasserspiegel. Keyenberg sollte auch weggebaggert werden, bleibt nun aber doch am Rande das Abbaues als fast leer stehendes Dorf stehen.
KuLaDig
Das virtuelle Museum der verlorenen Heimat
Nezenna / Warder
Kleine Inselburg eines wagrischen Herrschers. Der Wall hat nur noch eine Höhe von 2m. Angelegt wurde die Wallburg um das Jahr 900. In Folge der Expansion der Ostfranken unter Heinrich I. zwischen 928 und 936 wurde die Inselburg vermutlich verlassen. Reaktiviert wurde sie in der Zeitspanne von 973-983 durch Bischof Wago von Oldenburg, der hier einen seiner beiden Edelhöfe und Wohnsitze errichtete. Der Name Nezenna geht auf diesen Edelhof zurück (slaw. Nincina = Insel).
983 erhoben sich die Slawen, Mitte des 12.Jh. waren auf der Insel nur noch die Grundmauern eines Bethauses zu finden. Wann genau der Edelhof zu Grunde ging ist unklar. Ein Fundament aus Rollsteinen wurde 1975 bei Ausgrabungen gefunden und könnte den Rest dieser kleinen Kirche darstellen.
Das Betreten der Insel ist nur Mitgliedern des örtlichen Angel- oder Seglervereins gestattet. Dies gilt auch für das Befahren des Sees mit Booten. Durch das mit Grundstücken verbaute Ufer ist es kaum möglich einen Blick auf die Insel zu erhaschen.
Slawenburgen
Ringwall Pöppendorf
Frühslawischer Ringwall aus der Zeit des 8.Jh. bis zur ersten Jahrtausendwende. Vermutlich Sitz eines wagrischen Fürsten. Der Ringwall wurde verlassen, als in der Nähe die erste Lübecker Burg "Liubice" aus dem Jahr 817/819 nach ihrer Aufgabe um 900 wieder reaktiviert wurde.
Südwestlich des Ringwalls befand sich einst eine Siedlung. Auf seiner Ostseite ist der Durchlaß einer früheren Toranlage erkennbar. Der Ringwall hat einen Durchmesser von ca. 100-120m und ragt noch immer 8-12m über die Umgebung heraus. Der Ringwall liegt auf einem flachen Höhenrücken und war auf drei Seiten von einer sumpfartigen Niederung umgeben. Er gilt als einer der besterhaltenen slawischen Wehranlagen in Ost-Holstein.
Wikipedia
Slawische Wallburgen
Wallburg Großer Schlichtenberg
Ringwallanlagen sind bei vielen Kulturen anzutreffen gewesen. Typisch waren sie für die Slawen, die etwa ab dem 6.Jh. u.a. im heutigen Ostholstein siedelten. Die Angabe der Enstehungszeit des Ringwalls Großer Schlichtenberg ist je nach Quelle uneinheitlich. So wird einerseits das 11.Jh. genannt, andererseits die erste Siedlung durch Holzfunde auf das Jahr 1206/07 datiert. Diese erste befestigte Ansiedlung um einen deutschen Adelssitz herum erfolgte nach dem Abzug der Slawen. Eine zweite jüngere Siedlung auf dem Großen Schlichtenberg wurde bis in das 15.Jh. genutzt. Sie erhielt gegenüber der älteren Siedlung eine stärkere Befestigung und einen neuen Zuweg von Süden.
Die Grabungsbefunde dieser zweiten Bauphase lieferten die Grundlagen für die Rekonstruktion von Ritterhaus, Ofen, Scheune und Brunnen der Turmhügelburg Lütjenburg. Vor Ort ist der äußere Wall jenseits des Grabens nur noch sehr schwach erkennbar. Die Moränenkuppe ragt etwa 2,5m auf, der innere Wall erreicht eine Höhe von etwa 4m.
In unmittelbarer Nähe befindet sich die jüngere Motte des Kleinen Schlichtenbergs.
Wikipedia
Motte Schwanenmühle / Schwanenburg
Wahrscheinlich im 11. oder 12.Jh. erbaut. Der Erhaltungszustand ist überdurchschnittlich, Wälle und Gräben sind nicht nur sehr gut zu erkennen, sondern wären auch heute noch durch Flutung nutzbar. Baumaterial der Motte soll zum Bau der benachbarten Schwanenmühle verwendet worden sein, die 1341 erstmals in Dokumenten erwähnt wird. Die heutige Schwanenmühle ist allerdings ein Neubau aus den 1960er Jahren.
Die funktionelle Nachfolge der Motte Schwanenmühle trat um 1300 die Wasserburg "Haus Graven" an.
Wikipedia
EBIDAT
Sipsdorfer Schanze
Die etwa 120x140m umfassende slawische Wallburg geht vermutlich auf das 8.Jh. zurück. Vom Typus handelt es sich um eine Fluchtburg in Hügellage. Im Inneren des Walls liegt heute ein Gehöft. Seine Bewohner berichteten von einer weiteren nahen Verteidigungsanlage in nordwestlicher Richtung, bei der die Männer den Kampf ausgetragen hätten, während Frauen und Kinder in der Wallburg verblieben wären. Von dieser zweiten Anlage ist evtl. auf Satelliten-Radaraufnahmen ein schwächerer Ringwall zu erkennen, der heute in einer bewaldeten Flußniederung liegt. Allerdings gibt es gut 900m in südlicher Richtung noch eine weitere ringförmige Bodenstruktur ("Oolen Hoven").
Burg Stendorf
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei Burg Stendorf um die Reste einer slawischen Burg. Es hat hier noch keine archäologischen Untersuchungen gegeben, eine zeitliche Einordnung bleibt daher sehr vage.
Die vielleicht noch erkennbaren Bodenstrukturen liegen auf einem kleinen natürlichen Hügel. Sein Bewuchs ist derart dicht, dass - zumindest im Sommer - der Zugang über einen dornenreichen Pfad nicht möglich ist.
Süseler Schanze
Am Nordufer des Süseler Sees liegt die sogenannte "Süseler Schanze". Sie ist der Rest einer slawischen Wallburg, wohl einst Herrschaftssitz eines slawischen Fürsten. Süsel ("Suislegrad") war bis in das 12.Jh. einer der Hauptorte der slawischen Besiedlung. Gefundene Keramikreste lassen eine Datierung bis in das 7.Jh. zu, der Nutzungsschwerpunkt lag aber wohl im 9. und 10. Jahrhundert.
Die Wallburg lag in Ufernähe auf einem Burghügel, ihr Ringwall war bis zu 8m hoch. Von diesem ist kaum etwas übrig geblieben, im 19.Jh. wurde er zum größten Teil abgetragen. Zur Landseite hin sicherte im Abstand von ca. 60m ein zusätzlicher gebogener Wall eine Vorburg, auch seine Überbleibsel sind nur noch vage zu erkennen. Vom 70 bis 95m durchmessenden Burghügel hat man auch heute noch einen guten Überblick über die Umgebung.
Eine wichtige Rolle spielte die Süseler Schanze erst im 12.Jahrhundert. Es war die Zeit der Auseinandersetzungen zwischen den dort ansässigen heidnischen Wagriern und vordringenden christlichen Deutschen. Graf Adolf II. von Schauenburg war das nach Auseinandersetzungen dünn besiedelte Wagrien zugesprochen worden. Er rief Bauern in Flandern, Friesland und Westfalen auf, sich hier nieder zu lassen. Um Süsel herum siedelten sich Friesen an, ganze Planwagen-Trecks rollten seit 1143 heran. Die Friesen bevorzugten andere Böden als die slawischen Bauern, man trat in dieser Hinsicht nicht in direkte Konkurrenz. 1146 planten deutsche Fürsten einen Feldzug gegen Slawen im heutigen Mecklenburg. Ihnen kam 1147 Fürst Niklot, Anführer der slawischen Obotriten, jedoch zuvor. Unter seinem Kommando wurden Lübeck, Eutin und Süsel verwüstet.
In Süsel verschanzten sich etwa 100 Friesen in einer Wehranlage. Die 30m durchmessende Turmhügelburg in Süsel (zwischen Tannenberg und Bäderstraße gelegen) wird dafür zu klein und zudem jüngeren Datums gewesen sein, sehr wahrscheinlich spielte sich daher das Geschehen an der Süseler Schanze ab.
Der größte Teil der Süseler Friesen war bei Ankunft des slawischen Heeres in ihre ursprüngliche Heimat zurück gekehrt um dort ihr hinterlassenes Vermögen zu ordnen. Lediglich 100 von ihnen blieben in Süsel zurück und standen nun einem Heer von 3000 Angreifern gegenüber. Die Friesen zogen sich in die alte Festung zurück, der Ort Süsel wurde nieder gebrannt und die Obodriten spekulierten auf eine Aufgabe der Friesen. Dem trat der Priester Gerlach entgegen, der die Friesen zum Widerstand aufrief und auch selber zum Schwert griff. Als Graf Adolf II. hiervon erfuhr, sammelte er Truppen um die Obodriten aus Süsel zu verjagen. Die Kunde davon bewirkte, dass sich selbige von dort zurück zogen und sich mit ihrer Beute und Gefangenen in ihre Heimat absetzten.
Die hier gezeigten Fotos entstanden mit freundlicher Genehmigung des Grundstückeigentümers, das Betreten des Privatgrundes ist ansonsten untersagt.
Wikipedia
Motte Tüschenbroich
Vermutet wird eine Enstehung der Großmotte zu karolingischer Zeit im 9.Jahrhundert. Die erste urkundliche Erwähnung als Thuschinbroc ("mitten im Bruch") stammt allerdings aus dem 12.Jahrhundert (1172). Heute auf einer Insel gelegen, entsprach die Motte der Hauptburg der ersten Tüschenbroicher Burg. Diese erste Burg wurde in der Folgezeit durch einen Nachfolgebau ersetzt, dessen Baudatum ebenfalls unbekannt ist (irgendwann zwischen 1200 und 1456).
Für diese spätmittelalterliche Burg wurde der Mottenhügel möglicherweise eingeebnet und damit in der Höhe auf die heutigen ca. 10m reduziert. Der Burghügel misst an seiner Basis ca. 65m im Durchmesser. Sehr wahrscheinlich wurde er auf trockenem Grund aufgeschichtet und mit einem Graben umgeben. Der heutige Weiher wurde wohl erst im Spätmittelalter angelegt, als die Nachfolgeburg erbaut wurde. Die Hauptburg auf dem Mottenhügel wurde über eine gut 46m lange Brücke mit der Vorburg verbunden. Diese Nachfolgeburg wurde 1624 im 30jährigen Krieg durch Brand zerstört. Von ihr erhalten sind auf der Insel Reste einer Wehrmauer und eines Turmfragments, sowie ein Kellergewölbe mit Treppe.
Die Insel darf nicht betreten werden.
Auf der Fläche der spätmittelalterlichen Vorburg enstand später das Schloss Tüschenbroich.
Wikipedia
EBIDAT
Motte Große Burg Unterrath
Mitte bis Ende des 8.Jh. wurde wegen der anhaltenden Sachseneinfälle der Rather Königshof verstärkt. Zu seinem Schutz dienten vier Rittersitze mit Wasserburgen in Form von Motten. Die "Große Borch" ist heute das am besten erhaltene Überbleibsel dieser alten Wehranlagen aus der ehemaligen Honschaft Rath. Allerdings ist davon kaum etwas zu sehen, wenn man daran entlang spaziert. Der Pflanzenbestand behindert die Erkennbarkeit ganz erheblich. Es ist etwas Fantasie nötig, wenn man sich den früheren Zustand vorstellen will. Der abgestufte Turmhügel war einmal von einem inneren Wassergraben umgeben, der inzwischen (wasserstandsabhängig) zu mehr als der Hälfte trocken gefallen ist. Die Süd-Westseite des Turmhügels liegt direkt am westlichen Arm des Kittelbaches, der die heute wieder zu einer Insel gewordenen Motte umfließt. Die Ansicht alter Luftaufnahmen und die Bauweise anderer ähnlicher Motten läßt die Vermutung zu, dass der neu angelegte östliche Bacharm durchaus die historische Anlage mit einem zweiten äußeren Wassergraben nachahmt. Seit der Renaturierung des Kittelbaches ist die Motte nicht mehr begehbar.
weitere Infos unter "Lokalgeschichte"
Ringwall Hapelrath / "Virneburg"
In der Nähe von Hapelrath befindet sich in einer Waldrandlage ein halbkreisförmiger Wall. Auf seiner Nordseite wird er durch einen neuzeitlichen geradlinigen Damm mit steileren Flanken geschlossen, auf dem ein Wirtschaftsweg entlang läuft. Der Ringwall ist bislang nicht datiert, soll aber germanischen Ursprungs sein.
Ein nordöstlich davon gelegener kleiner Hügel bot Anlaß für die Spekulation, es hier mit der untergegangenen "Virneburg" - einer alten Motte - zu tun zu haben.
Zur Zeit der Erbauung dürfte das Umfeld des Ringwalls - anders als heute - einen sumpfigen Charakter gehabt haben. Wasserbaumaßnahmen der vergangenen Jahrhunderte haben die Landschaft inzwischen verändert.
Wikipedia
Die Geschichte der Virneburg (archive.org)
Motte / Burg Wassenberg
Wassenberg besitzt sowohl eine frühmittelalterliche Motte aus dem Anfang des 11.Jh., als auch über die Reste einer Burg des frühen 15.Jh. .
Im jahr 1121 wurde Gerardus I. Flameus mit Wasserberg belehnt, der sich fortan Gerhard Graf von Wassenberg nennen ließ. Damit dürfte wohl auf sein Bestreben der Bau der Motte zurück zu führen sein. Sein Geschlecht entwickelte sich durch Erweiterungen des Machtbereiches zu den Herren des Grafentums Geldern.
Der auf der Motte stehende Bergfried geht auf eine Bauzeit zwischen 1400 und 1420 zurück. Er war bereits vor 1800 nur noch als Ruine erhalten. Weitere Reste der spätmittelalterlichen Burg befinden sich im Untergeschoss der Unterburg aus dem 18.Jh.
EBIDAT
Wikipedia
Motte Wevelinghoven
Die Motte in Wevelinghoven ist nicht unumstritten. 1985 wurde dem Hügel attestiert, dass es keine archäologischen Beweise für seine Funktion gäbe und seine regelmäßige Kegelform nicht dem Typus einer Motte entspräche.
Auf der anderen Seite entspricht seine Lage der von anderen Motten im Tal der Erft. Mit einigem Abstand verläuft rings um den Hügel eine halbkreisförmige schwach erkennbare Grabenstruktur (alter Erftarm?), wie sie typisch für alte Befestigungsanlagen wäre. Die schnurgerade gezogenen Gräben sind ebenso neuzeitlichen Alters wie der Pavillon auf der Spitze des Hügels.
Im Jahr 1096 wurde Wevelinghoven als ein "sicherer Ort" für Schutz suchende Juden erwähnt. Ein "sicherer Ort" sollte sehr wahrscheinlich auch über eine befestigte Anlage verfügt haben - was für die Existenz einer Motte spräche. Nachdem an anderen niederrheinischen Orten marodierende Banden jüdische Gemeinschaften umgebracht hatten, wählte die jüdische Gemeinde in Wevelinghoven den gemeinschaftlichen Freitod.
Auf der heute gegenüberliegenden Uferseite der Erft entstand ein "festes Haus" - dies war die Burg der Herren von Wevelinghoven. Sie ging 1584 im Truchsessischen Krieg unter.
Historisches Wevelinghoven
Maiss-Müller
Quelle: www.lipinski.de/burgen/11jahrhundert.php
Abgerufen: 22.10.2024 - 21:14 Uhr
Autor: Klaus Lipinski, Düsseldorf
Email: info(at)lipinski.de
Texte und Fotos unterliegen den auf der Website definierten Urheberrechten.
Abgerufen: 22.10.2024 - 21:14 Uhr
Autor: Klaus Lipinski, Düsseldorf
Email: info(at)lipinski.de
Texte und Fotos unterliegen den auf der Website definierten Urheberrechten.